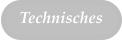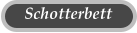Gleisabschluss
Ein Gleisabschluss steht für verschiedene Einrichtungen in Gleisanlagen, die das Weiterrollen von Schienenfahrzeugen über das Gleisende hinaus verhindern sollen. Ein Gleisabschluss kann ein Prellbock, ein Schwellenkranz, eine Kopf- oder Stirnrampe, ein Gleisschuh, ein Erd- oder Sandhaufen oder ein Gleisendschuh sein. Auf diesen Seiten ist der Prellbock, Puffer oder auch Pufferwehr genannt der Themenschwerpunkt. Er gehört zu einer ganz besonderen Gattung der Eisenbahn. Man findet ihn am häufigsten in Bahnhöfen. Er ist ein Überlebenskünstler ohne Beispiel und seine Vielfalt ist wohl den Erbauern dieser besonderen Gattung geschuldet. Prellböcke gibt es noch aus der Anfangszeit der Eisenbahn, speziell in kleinen Bahnhöfen. Selbst wo die Gleisanlagen zurückgebaut wurden, lässt man den Prellbock auf einem Gleisstück, wie ein Denkmal, stehen. Ein Prellbock ist ein Gleisabschluss Der Prellbock ist ein mehr oder wenig aufwendig gebauter Gleisabschluss. Er dient dem Aufhalten von Fahrzeugen über deren Mittel- oder Seitenpuffer. Es gibt verschiedene Prellbockarten: Bremsprellbock, Festprellbock, Sandbremsbock und Mittelpufferprellbock. Die Bauausführungen lassen sich nicht beziffern. Die Pufferbohle des Prellbocks ist meistens aus Holz gefertigt. Der Prellbock wird immer durch ein Gleissperrsignal gesichert. Fährt ein Fahrzeug auf den Prellbock auf, so soll dieser es abbremsen und zum Stehen bringen. Die beim Abbremsen auftretenden Schäden am Fahrzeug sollen sich in Grenzen halten oder gar nicht erst auftreten. Die Prellbockbohlen müssen auch den unterschiedlichen Kupplungen der eingesetzten Fahrzeuge Rechnung tragen. Beim gemischten Einsatz muss die Bohle so geschaffen sein, dass sie Mittel- und Seitenpufferfahrzeuge auffangen kann. Der einfachste Prellbock, der überwiegend im 19. Jahrhundert hergestellt wurde, war ein mit Erde aufgefüllter Schwellenkasten. Während des Zweiten Weltkriegs bauten die Bahnmeistereien die Prellböcke aus Altmaterial. Aufgrund des Stahlmangels wurden dann auch Betonprellböcke hergestellt. Diese waren für das Abbremsen gänzlich ungeeignet. Trotz einschlägiger Anweisungen wurden bis in die heutige Zeit immer wieder feste Prellböcke gebaut. Der Festprellbock wird aus Schienen, Mauerwerk, Profileisen oder Holzbohlen gefertigt. Die Fahrzeugpuffer stoßen beim Aufprall auf eine Bohle oder der Prellbock verfügt über gefederte Puffer und kann so den Aufprall dämpfen. Ein Puffer muss die Fliehkräfte des Fahrzeugs auffangen, ableiten und es zum Stehen bringen. Dabei spielt natürlich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und sein Gewicht eine große Rolle. Nach dem Aufprall entsteht ein Rückstoß. Dieser darf nicht zu hoch sein, da sonst das Fahrzeug zurückrollen und andere gefährden könnte. Ein Prellbock ist für einen Aufprall von 1 m je Sekunde ausgelegt. Der feste Prellbock wurde mit Wirkung vom 14. April 1926 nicht mehr verwendet, weil die Schäden an den Fahrzeugen zu hoch waren. Jetzt wurden verschiebbare Prellböcke eingesetzt. Diese waren mit der Schiene verbunden und konnten an ihnen entlang rutschen, bis das Fahrzeug zum Stehen kam. Ihr weiterer Vorteil war, sie konnten zur Reparatur entfernt und danach wieder eingesetzt werden. Der Bremsprellbock war geboren. Beim Aufprall vernichtet eine Kiesfüllung die Energie des Aufpralls. Der Prellbock gleitet dann auf den Schienen entlang. Nach einem Aufprall konnte der Prellbock mit einer Lok wieder zurückgezogen werden und mit Kies aufgefüllt werden. Der Bremsprellbock vermag bis zu 1.200 t aufzufangen. Der Bremsprellbock wird in fünf Bauarten unterteilt: Gleisbrems-, Schleppschwellen-, Gliederrost, Zungen-, und Sandbremsprellbock. Der Gleisbremsprellbock ist konstruktiv einfach und wird durch Klemmvorrichtungen an der Schiene festgeschraubt. Das erzeugt eine hohe Reibung. Trifft ein Fahrzeug auf diesen Prellbock, verschiebt das Fahrzeug diesen, bis es zum Stillstand gekommen ist. Nach dem Aufprall werden die Klemmschrauben gelöst und eine Lokomotive kann den Prellbock mittels Seil wieder in die Ausgangsposition bringen. Der Schleppschwellenbremsprellbock ist so konstruiert, dass beim Verschieben des Puffers, der über Ketten mit den Schienenschwellen verbunden ist, die Schwellen mitgeschleppt werden. Das erhöht die Bremskraft ganz erheblich, verursacht aber einigen Schaden an den Schienen. Einsatz findet dieser Prellbock überall dort, wo der Bremsweg zu kurz oder die Fahrzeuge schwer sind. Der Gliederrostbremsprellbock arbeitet ähnlich, jedoch werden hier mit wachsender Aufpralllänge immer mehr Schwellen nachgezogen. Der Prellbock ist hier durch mehrere Ketten mit je einer Schwelle verbunden. Je größer der Bremsweg ist, desto mehr Schwellen werden mitgeschleppt. Die Schwellen sind hier meist aus Beton. Diese Prellbockart wird häufig auf Kopfbahnhöfen eingesetzt, wo sich viele Menschen hinter dem Prellbock bewegen. Der Zungenbremsprellbock nutzt das Gewicht des aufprallenden Fahrzeugs, um Reibung zu erzeugen. Hier sind die Schwellen unter dem Gleis in einer Hülse angebracht. Die Schienen sind seitlich auf das Mauerwerk abgestützt. Wird der Prellbock angefahren, wird der Rost, wie bei einem Messer, das aus der Scheide geholt wird unter dem Gleis hervorgezogen. Der Prellbock bremst immer mehr, je länger der Bremsweg ist. Hier wird das Fahrzeug kontinuierlich und sanft abgebremst. Der Sandbremsprellbock wird am Kopf der Fahrschiene geführt. Die Bremswirkung entsteht dadurch, dass das Fahrzeug einen Sandhaufen vor sich herschiebt und ihn auftürmt. Nach dem Aufprall muss der Sand wieder aufgeschaufelt werden. Der hydraulische Bremsprellbock, der hauptsächlich in Kopfbahnhöfen eingesetzt wird, ähnelt dem Sandbremsprellbock. Hier wird Öl oder Wasser in zwei Zylindern beim Aufprall des Fahrzeugs zusammengepresst und durch eine Öffnung im Kolben auf die andere Kolbenseite gedrückt.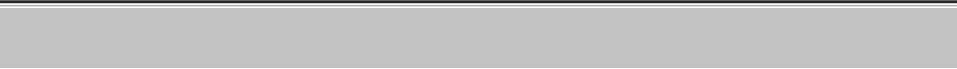
© Copyright 2017 - 2025 - Burkhard Thiel - alle Rechte vorbehalten






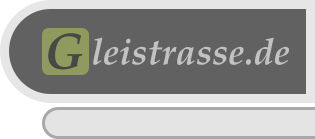
Impressionen entlang des Schienenstrangs

zu den 144 Prellböcken